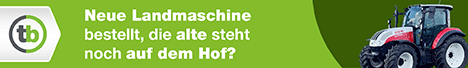Unser Wintergarten in Andalusien
Vom Mond sieht man zwei menschliche Bauwerke: Die chinesische Mauer und das „Plastikmeer“ von Almeria. Auf agrarisch Interessierte übt dieses eine seltsame Faszination aus. STEFAN NIMMERVOLL hat sich von der surrealen Umgebung packen lassen.
Im ärmlichen Süden Spaniens gab es lange Zeit nur ein einziges Exportgut: Auswanderer, die der Trostlosigkeit ihrer Heimat entgehen wollten. Dabei hatten die Küstenregionen Andalusiens durchaus Schätze zu bieten: Ihre Strände sollten später, geschickt unter Namen wie „Sonnenküste“ (Costa del Sol) vermarktet, einer der Hotspots des Massentourismus am Mittelmeer werden. Und das Grundwasser, das von der Schneeschmelze der Sierra Nevada gespeist wird, sollte zum Elixier eines Booms, der das Antlitz einer ganzen Provinz veränderte, werden. Das Potential von beidem erkannte das um Devisen ringende faschistische Franco-Regime in den 1960-er Jahren und begann am Reißbrett Infrastruktur dafür zu schaffen.
Im Umland Almerias wurden also neue Dörfer errichtet und Bauern aus dem Landesinneren geholt, um das Projekt eines intensiven Gemüseanbaus umzusetzen. Sie hatten zuvor zumeist Tafeltrauben angebaut, wurden quasi auf Paradeiser und Paprika umgeschult. Auf die kargen Böden wurde Humus und Mist aufgetragen und bald die ersten provisorischen Gewächshäuser errichtet. Heute erinnert nichts mehr an die Einöde, in der sogar Western gedreht wurden, weil sie dem Wilden Westen so ähnelte. Aus einer Gegend, in der nichts angebaut werden konnte, wurde der Wintergarten Europas. Entlang des schmalen Küstenstreifens einer einzigen Provinz wächst heute mehr Gemüse als in ganz Deutschland, Portugal oder Griechenland. Wer im mitteleuropäischen Dezember im Supermarkt zu frischen Vitaminen greift, hat gute Chancen, ein Produkt aus Almeria in Händen zu halten.
Von mehr als 14.000 Landwirten wird heute auf 33.500 Hektar unter bis über den Horizont hinaus reichenden Fetzendächern eines der intensivsten agrarischen Produktionssysteme, die es auf Erden gibt, betrieben. Wirtschaftlich hat das einen Boom nach sich gezogen. Fast 4 Mio. Tonnen Gemüse werden geerntet, ein Milliardenumsatz wird generiert. Die Einwohnerzahl ist von 350.000 auf fast 700.000 gestiegen. Der Ausländeranteil ist dabei höher als in der Metropole Madrid. Zwei Drittel der Farmarbeiter sind heute keine Spanier. Viele Migranten schuften sich in den Gewächshäusern krumm und bucklig. Manchmal werden die Verhältnisse, unter diese leben müssen, als sklavenähnlich bezeichnet. Der Wahrheitsgehalt dieser Behauptungen lässt sich bei einem Besuch ohne investigative Recherche allerdings nur schwer überprüfen. „Das Image des Sektors ist jedenfalls schlecht. Die meisten Leute wissen aber nicht, was in den Gewächshäusern tatsächlich passiert“, meint Juan Carlos Perez-Mesa vom Verband Hortiespana.
Der Umgang mit den Arbeitskräften ist ohnehin nur ein wunder Punkt von mehreren. Das „Mar del Plastico“ steht auch als Sinnbild für uferlosen Pestizideinsatz und als Auswuchs einer auf Profitmaximierung ausgerichteten Produktion. Dass immer alles eitel Wonne war, möchte der Agronom Jan van der Blom, der aus Holland, der anderen Gemüsehochburg Europas, nach Spanien gekommen ist, gar nicht behaupten. Pflanzenschutzmittel seien lange exzessiv angewendet worden. „Vieles wurde falsch gemacht. Mitte der 2000-er Jahre haben Thripse, die gegen alle zugelassenen Insektizide resistent waren, bei Paprika einen Virus übertragen. In ihrer Verzweiflung haben die Bauern dann verbotene Pestizide angewendet.“ Das blieb nicht lange unentdeckt. Der Aufschrei im wichtigsten Abnehmerland Deutschland war groß, der Absatz brach ein. Viele Gärtner standen am Rande des Ruins. Der Skandal sollte aber auch ein Wendepunkt sein: „Von 2006 auf 2007 ist der Einsatz von Nützlingen bei Paprika von einer Fläche von 150 auf 8.000 Hektar gestiegen“, so van der Bloom. Heute ist integrierte Produktion Standard, Insektizide sind praktisch völlig verschwunden. Gegen Pilzkrankheiten wird noch gespritzt. Der Bio-Anteil beträgt aber bereits 15 Prozent. Auch das Chamäleon ist als Zeigerart in die Gewächshäuser eingekehrt.
Ein weiterer Anlass zur Kritik ist der Wasserverbrauch. Andalusien hat gerade fünf Jahre der Dürre hinter sich. Während sich andere Verbraucher einschränken müssen, wird in den Gewächshäusern weiter eifrig gepritschelt. „Wir arbeiten an der Effizienz“, sagt Ramon Gil Perez, der Direktor des Forschungszentrums Las Palmerillas in El Ejio im Herzen des Anbaugebietes. Dieses wird von der Grupo Cooperativo Cajamar, einer genossenschaftlichen Bank, betrieben. „Almerias Gartenbau braucht nur 1,8 Prozent des Bewässerungswassers Spaniens, generiert aber acht Prozent der landwirtschaftlichen Wertschöpfung und 24 Prozent der Gartenbauwertschöpfung des Landes“, kalmiert er. Längst wird auch das Regenwasser, das an den Planen abrinnt, gesammelt. 20 Prozent des Wasserbedarfs wird zudem mit Entsalzungsanlagen aus dem Meer gewonnen. Das kostet: Pro Kubikmeter Wasser im Mix aller Quellen sind 60 Cent zu veranschlagen. Damit werden 30 Kilo Tomaten hergestellt und eine Wertschöpfung von 16 Euro erzielt.
Eine Zeit lang wurden sogar der Pläne gewälzt, Kanäle aus dem feuchteren Norden in den Süden Spaniens zu graben. Dieses umstrittene Projekt, für das bereits Land entlang der Routen angekauft wurde, ist nach einem Regierungswechsel aber zu den Akten gelegt worden. Immer noch kommt der Großteil des Wassers daher aus den Brunnen Almerias. Die Bauern sind zuversichtlich, trotz der zunehmenden Trockenheit noch für lange Zeit ausreichend Ressourcen zu haben. Der Grundwasserspiegel sei sogar gestiegen, der Salzgehalt hat allerdings zugenommen, weil Meerwasser hereingedrückt wird. Und Altlasten der Überdüngung von früher ziehen schlechte Werte nach sich, erzählt Juan Carlos Perez-Mesa. Daher werden die Speicher mit desaliniertem Wasser aufgebessert. Man hat sich zum Ziel gesetzt, den Verbrauch pro Hektar um 15 bis 20 Prozent zu reduzieren.
Bleibt noch die Frage des Mülls: Die Plastikbahnen der Gewächshäuser müssen spätestens alle vier Jahr gewechselt werden. Früher wurden die gewaltigen Mengen oft illegal deponiert. Das gehört weitgehend der Vergangenheit an. „Jeder Verstoß zerstört unsere Glaubwürdigkeit“, sagt Jan van der Blom. Deshalb werden 30.000 Tonnen pro Jahr dem Recycling zugeführt. „Pro Kilo Tomaten fallen nur acht bis neun Gramm Plastik an.“ Wie in allen Bereichen versucht man auch hier den Nachhaltigkeitsaspekt zu betonen. Almeria will weg davon, als Synonym für industrielle Gemüseproduktion zu gelten. Letztlich macht das auch der Markt notwendig. Denn die wirkliche Billigproduktion ist längst weitergezogen: Spaniens Gemüsebauern haben ihr Know-How über das Meer nach Marokko transferiert. Dort gelten dann aktuell wirklich noch gar keine Regeln.
Der Beitrag Unser Wintergarten in Andalusien erschien zuerst auf Blick ins Land.