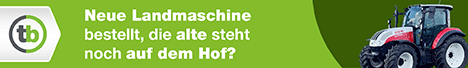Miteinander, nicht übereinander reden
Umweltschutzorganisationen werden von Landwirtschaftsvertretern oft als Gegner betrachtet. Die Greenpeace-Wirtschaftsexpertin URSULA BITTNER betont im Gespräch mit STEFAN NIMMERVOLL lieber die gemeinsamen Interessen.
Direkte Frage: Ist Greenpeace ein Feind der Landwirtschaft?
Nein. Die Landwirtschaft ist Mitverursacher von manchen Klima- und Umweltproblemen, aber auch Betroffener und ein Teil der Lösung. Deswegen brauchen wir Zusammenarbeit und nicht Feindschaft.
Warum wird Greenpeace dann von vielen als Feindbild gesehen?
Als Sprachrohr für die Umwelt fordern wir Veränderungen ein. Im ersten Moment kann man uns deswegen vielleicht als Feind betrachten. Im Grunde genommen wollen wir aber ein Umdenken zum Wohle einer kleinstrukturierten Produktion, wie es sie in Österreich gibt. Wogegen wir uns aber klar stellen sind agroindustrielle Konzerne und Methoden, die nicht nur in hohem Maß umweltzerstörend sind, sondern oft auch kleinere bäuerliche Betriebe zu Tode konkurrenzieren. Von uns gibt es jedenfalls große Bereitschaft, miteinander und nicht nur übereinander zu sprechen.
Die Bauern profitieren also letztlich von der Arbeit von Greenpeace?
Wir kommunizieren den Mehrwert der heimischen Landwirtschaft. So sind wir zum Beispiel dafür, dass keine Produkte mehr importiert werden, mit denen österreichische Standards unterschritten werden und lehnen, so wie rund 90% aller Bauern, das Freihandelsabkommen Mercosur ab.
So harmonisch, wie es sich das jetzt anhört, ist das Verhältnis aber nicht immer. Wo muss den die österreichische Landwirtschaft besser werden?
Bei der biologischen Landwirtschaft sind wir im Vergleich zu anderen Ländern nicht schlecht. Da muss aber noch mehr gehen – vor allem in der Tierzucht. Beispielsweise sind nur etwa 2,4 Prozent der schweinehaltenden Betriebe in Österreich Biobetriebe. Und bei der Nutzung unserer Ackerflächen brauchen wir mehr Balance zwischen dem Anbau für die Tierhaltung und für den direkten menschlichen Konsum. Dass, inklusive der Weiden, 80 Prozent der Flächen zur Produktion von Futter für Nutztiere verwendet werden, ist zu viel. Wir produzieren verhältnismäßig zu wenig Gemüse und Obst und zu viel Fleisch.
Muss man denn Veganer sein, um ein guter Umweltschützer zu sein?
Nein, aber wir müssen insgesamt deutlich weniger Fleisch essen und tierische Lebensmittel umweltfreundlicher produzieren. Wir sind für eine differenzierte Betrachtung. Natürlich ist es in den Berggebieten am sinnvollsten, Kühe zu halten. Menschen können kein Gras essen. Tieren massiv Kraftfutter zu geben, ist aber nicht richtig. Unsere Vision ist es, bis 2050 die Hälfte des Konsums tierischer Lebensmittel einzusparen. Damit würden viele Flächen für die Erhaltung der Biodiversität frei werden.
Ihre Kollegen von Greenpeace Deutschland fordern sogar ein Werbeverbot für Fleisch. Sollen auf der Tasse künftig Schockbilder wie bei den Zigaretten drauf sein?
Es wird auf politischer Ebene Änderungen geben müssen. Wenn das gelingt und wir gemeinsam mit der Landwirtschaft für weniger Fleisch, dafür in höherer Qualität, werben, und unsere Förderungen umschichten wird es keine Schockbilder brauchen.
Also keine Verbote, sondern Anreize?
Anreize sind wichtig, aber es braucht vor allem klare gesetzliche Rahmenbedingungen im Bereich Lebensmittelproduktion, Lieferketten, beim Tierschutz und Waldschutz. Was man sich bei Fleisch und anderen Lebensmitteln schon anschauen muss, ist, wohin öffentliche Gelder gehen. Eine Bindung an umweltbezogene Maßnahmen wäre da sehr wichtig. Wer zum Beispiel Glyphosat verwendet, soll keine Förderungen bekommen können. Da treten wir auch für die Förderung von Alternativen ein, die es ab 2022 nach dem Auslaufen der EU-weiten Zulassung ohnehin brauchen wird.
Der Vorschlag zur Gemeinsamen Agrarpolitik geht ja in die Richtung einer solchen stärkeren Bindung. Zufrieden?
Zum Teil. Man müsste die Direktzahlungen in der ersten Säule aber noch viel mehr an eine umweltfreundliche, biologische Bewirtschaftung koppeln und viel weniger bloß die Bewirtschaftung der Fläche fördern. Und wenn wir für die ersten Hektar besser zahlen würden, würde das die kleinstrukturierte Produktion stützen. Je größer, desto mehr, führt nicht zum Ziel.
Was halten Sie von einer verpflichtenden Herkunftskennzeichnung, wie sie die Landwirtschaftskammer fordert?
Wir halten das in der Gastronomie und bei verarbeiteten Produkten für absolut notwendig. Es sollte aber nicht nur die geografische Herkunft, sondern auch die Haltungsform ausgewiesen werden.
Greenpeace kooperiert auch mit der Wirtschaft, zum Beispiel bei der Glasflasche mit der der Berglandmilch. Was haben Sie davon?
Wir selber können keine Milch in Glasflaschen auf den Markt bringen. Wenn Unternehmen ökologisch wertvolle Projekte entwickeln, sind wir aber gerne bereit, das auch zu unterstützen und mitzutragen.
Ist es nicht eine Art von Greenwashing?
Wenn ein Unternehmen es ernst meint und in seinem Kerngeschäft auf eine umweltfreundliche Produktionsweise umstellen will, ist das unterstützenswert. Unglaubwürdig sind hingegen Greenwashing-Projekte von Unternehmen, die außerhalb ihres Kerngeschäfts mit Umweltschutz werben. Etwa ein Ölkonzern, der ein paar Bäume pflanzt, aber nichts in seinem Kerngeschäft ändert. Wir stellen deshalb klar und transparent dar, worum es bei solchen Kooperationen geht. Wir nehmen weder von Unternehmen, noch dem Staat oder der EU Geld und gehen keinem Unternehmen gegenüber Verpflichtungen ein.
Es steht aber durchaus der Vorwurf im Raum, dass NGOs Kampagnen nach der Vermarktungstauglichkeit und dem Potential für Spenden auswählen.
Natürlich müssen wir Mitarbeiter bezahlen. Wir haben aber keine Shareholder, denen wir Gewinne ausschütten müssen. Wir machen auch keine Themen, bei denen wir nicht überzeugt sind, dass es gerechtfertigt ist, sich dafür einzusetzen.
Aktuell gibt sich auch ziemlich jeder Hersteller von Agrochemie betont grün. Sind auch mit solchen Konzernen Schnittmengen vorhanden?
Einzelne Projekte können da ja durchaus sinnvoll sein. Es geht aber auch darum, wie sich ein Konzern in seinem Kerngeschäft verhält und was der Unternehmensinhalt ist. Sich mit kleineren Maßnahmen zu schmücken, an der grundsätzlichen Ausrichtung bei chemisch-synthetischen Pestiziden und der Gentechnik aber nichts zu ändern, ist nicht genug.
Ähnlich kritisch sind sie bei Logos, die auf vielen Verpackungen prangen.
Viele private Gütezeichen suggerieren, dass die Produkte verantwortungsvoll, nachhaltig und umweltbewusst produziert werden. Wir haben in einer Analyse gesehen, dass die meisten nicht das halten, was sie versprechen. Sei es, weil der Standard zu schwach ist und von den Interessen der Industrie dominiert wird oder weil nicht ausreichend kontrolliert wird. Im schlimmsten Fall greift ein Konsument dann zu einem zertifizierten Palmöl aus Indonesien statt zu einem heimischen Rapsöl ohne Zertifikat. Damit schafft man einen unfairen Wettbewerbsvorteil. Das ist auch für die heimische Landwirtschaft nicht gut.
Ursula Bittner hat 2011 den Verein Donau Soja mitgegründet. Seit 2018 ist sie Wirtschaftsexpertin bei Greenpeace.
Der Beitrag Miteinander, nicht übereinander reden erschien zuerst auf Blick ins Land.